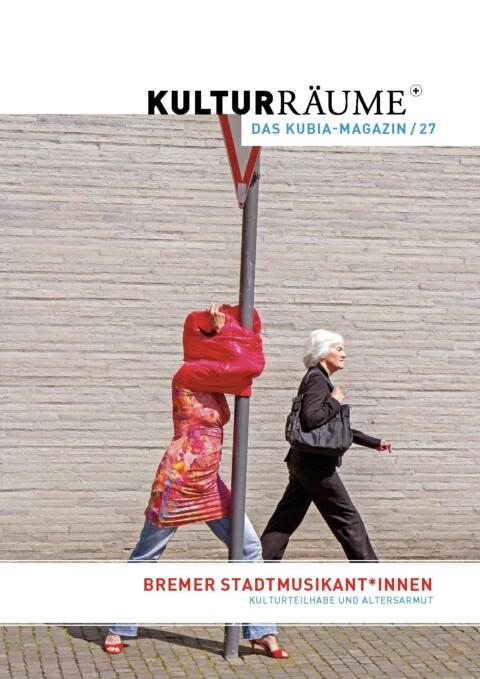Eines ist schnell klar: Dies ist kein Sonntagsspaziergang. Hier auf dem Carlswerk-Gelände, wo einst die Drahtfabrik von Felten und Guilleaume Telefonkabel und Drahtseile produzierte und heute das Schauspiel Köln seine Interimsspielstätte hat, gibt es was auf die Ohren: „Meine Mutter ist eine Arbeiterin, mein Vater ist ein Arbeiter. Ich bin eine Arbeitertochter. Ich liebe Arbeiter*innen. Arbeiter*innen haben mir geholfen, ich helfe den Arbeiter*innen. Ich konnte mich nie an die Reichen gewöhnen, die mit Abscheu die Klassen unter ihnen verachten.“ Diese Zeilen aus einem Gedicht der Lyrikerin Semra Ertan (2020) klingen dem Publikum erst auf Deutsch, dann auf Türkisch über Kopfhörer in den Ohren. Von Station zu Station laufen wir über das ehemalige Fabrikgelände im rechtsrheinischen Köln-Mülheim, auf dem sich inzwischen viele Kreative angesiedelt haben.
Deniz Yilmaz ist Viele
Das Stück erzählt die Geschichte des migrantischen Arbeitskampfs am Beispiel der fiktiven Figur Deniz Yılmaz. Das intergenerationelle Ensemble begibt sich mit dem Publikum auf die Suche nach dieser Figur, die das Bindeglied für die Szenenfolge bildet. Weder auf ein Geschlecht noch auf ein Alter festgelegt, wurde die Kunstfigur aus den Erfahrungen und Erzählungen des Ensembles zusammengesetzt. Alle Darsteller*innen fügen Deniz Yilmaz eine Facette hinzu. Zu Fragen wie „Was bedeutet das Thema Migration für mich? Was sind meine ersten Assoziationen beim Thema Arbeiterkampf?“ haben sie Briefe, Gedichte, Songs, fiktionale ebenso wie autobiografische Texte verfasst, die die Dramaturgin Johanna Rummeny in kunstvoller Kleinarbeit für den performativen Rundgang zusammengefügt hat.
Wilde Streiks
Über den wilden Streik im August 1973 wussten viele der jüngeren Spieler*innen vorher kaum etwas. Dabei war es der erste größere Arbeitskampf in der Bundesrepublik Deutschland, der vor allem von Arbeitsmigrant*innen getragen wurde. Besonders viel kann Mitat Özdemir als Zeitzeuge seinen Mitspieler*innen darüber erzählen. Er arbeitete bei Ford zunächst in der Fabrik und später als Sozialbetreuer für Arbeitsmigrant*innen, wo er Zeuge des Streiks wurde. Später machte er sich auf der Kölner Keupstraße selbstständig und war lange Zeit im Vorstand der Interessengemeinschaft Keupstraße aktiv. Seit vielen Jahren setzt er sich für Aufklärung im NSU-Komplex ein. Auch Ismet Büyük ist Spieler in „Drahtseilakt“. Er wirkte schon maßgeblich an den beiden Schauspiel-Produktionen „Die Lücke“ und „Die Lücke 2.0“ mit und sprach dort über seine Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland, das Attentat auf der ans Carlswerk angrenzenden Keupstraße, die Ermittlungen und schließlich den NSU-Prozess.
Arbeiterkampf ist Klassenkampf
Das intergenerationelle Ensemble habe während der Stückentwicklung immer wieder über den Zusammenhang von Klassismus, Rassismus und Arbeiterkampf diskutiert, so Saliha Shagasi. In welcher Weise und durch welche soziale Praktiken werden Menschen sowohl aufgrund ihrer geografischen als auch sozialen Herkunft, ihrer ökonomischen Position und ihrer Milieuzugehörigkeit voneinander unterschieden? Und wie steht es heute um die Arbeiterbewegung und den Klassenkampf? Shagasi erzählt, dass sehr viel über die schlecht bezahlte Arbeit von Migrant*innen debattiert wurde und auch über deren Praktiken des Sparens: „Das hat mit Klassismus insofern zu tun, als dass man sich hier so stark zurücknimmt, um zu sparen für den großen Traum, in die Heimat zurückzukehren. Aber natürlich auch damit, dass man hart schuftet und seinen Körper kaputt macht für Jobs, die die Deutschen nicht machen wollen.“ Geld sparen, um den Kindern ein Studium und ein „besseres Leben« zu ermöglichen, reiche in unserem Land aber nicht aus. Shagasi kritisiert, wie es migrantischen Kindern strukturell erschwert wird, den Bildungsaufstieg zu schaffen: „Diese Erzählung von ›jede und jeder kann es schaffen‹ stimmt einfach nicht.“ Eine der stärksten Szenen haben die jüngeren Spieler*innen inszeniert. Darin geht es um das „Posen, dieses So-Tun, als sei alles total klasse und man hätte genug Geld, und es würde einem gut gehen, weil man nicht als Loser dastehen will“ – sowohl vor der eigenen Familie im Herkunftsland, aber auch gegenüber der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. „Diesen Wunsch“, glaubt Shagasi, „können auch Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, sondern arm sind, sehr gut nachvollziehen.“
Intergenerationelle Vielfalt
Saliha Shagasi betont, dass die intergenerationelle Theaterarbeit davon profitiert habe, dass die Gruppe sich mit Klassismus, Rassismus und Arbeiterkampf Themen gewidmet hat, die alle Generationen angehen. Es seien in dem nicht professionellen Ensemble zwar nicht alle Spieler*innen in gleicher Weise davon betroffen, aber alle hätten sich damit verbinden können, weil sie, wenn nicht rassistische und klassistische, dann andere Diskriminierungserfahrungen gemacht hätten. Schnell sei im Ensemble klar gewesen, dass das Stück in deutscher, aber in Teilen auch in türkischer Sprache gespielt wird, ohne dass eine deutsche Übersetzung angeboten wird. Die Regisseurin berichtet, dass sich darüber im Publikum viele Menschen, die zweisprachig sind, gefreut haben. Alle anderen hätten sehr schnell verstanden, dass „jetzt auch mal sie in der Position sind, nicht alles zu verstehen“.
Theater gegen Rassismus
In die Zeit der Stückentwicklung und der Proben fielen die journalistischen Aufdeckungen über die rassistischen „Remigrationspläne“ der AfD. Als allen klar wurde, wie ernst die Lage ist, hätten sie in der Probe „einfach nur im Kreis gesessen und sich miteinander über ihre Ängste ausgetauscht“. Im Magazin des Schauspiel Köln formuliert Shagasi (2024) unter dem Eindruck der Ereignisse, was ihrer Ansicht nach die Aufgabe des Theaters ist: „So sehr das Theater uns ein Fliehen in andere Realitäten bietet, so sehr hat es […] – vor allem als staatlich geförderte Institution – die Pflicht, die Realitäten vor den Türen nicht auszublenden, sondern sie mitzunehmen auf die Bühne. Nicht stereotypisierend, sondern Realitäten aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und zu erzählen.“
Starker Draht
Zwischen dem Schauspiel Köln und der Initiative Keupstraße ist in den Jahren der engen Nachbarschaft und wiederholten Zusammenarbeit ein guter Draht entstanden. „Drahtseilakt“ ist ein Beispiel dafür, wie die nicht immer einfache Verbindung von Kultureller und Politischer Bildung so gelingen kann, dass sie – zumindest im Kontext des Projekts – den Draht zwischen den Generationen in einer postmigrantischen Gesellschaft stärkt. Von solchen politischen Generationendialogen im Medium der Künste braucht es gerade heute mehr denn je: „Nie wieder!“ ist jetzt.