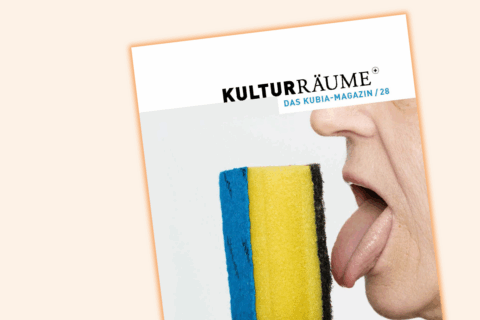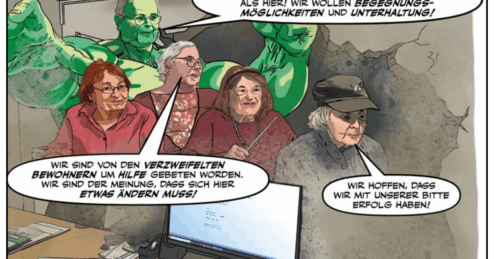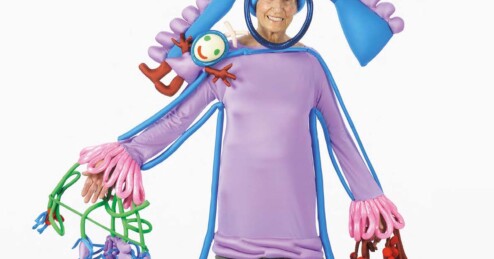Die Disziplin Musikgeragogik beschäftigt sich mit der Didaktik und Methodik des Musizierens im Alter. Neben der interdisziplinären Theorieentwicklung soll Musikgeragogik in der Praxis älteren und alten Menschen flächendeckend einen gesicherten, qualitativ hochwertigen und barrierefreien Zugang zur Teilhabe am musikalischen Lernen und Musizieren ermöglichen – und dies in allen Lebensphasen und Lebenslagen im Alter, also etwa auch bei Hochaltrigkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Wissenschaftsdisziplin
Die akademische Verortung und Ausdifferenzierung der Disziplin Musikgeragogik kann nunmehr auf eine gut 25-jährige Geschichte zurückblicken. An der FH Münster findet die musikalische Bildung von und musikalische Praxis mit älteren und alten Menschen erstmals Berücksichtigung in der 1997 von dem Gerontopsychologen Norbert Erlemeier initiierten Ringvorlesung „Gesichter und Gesichtspunkte des Alterns und Alters“. Gleichzeitig bieten Rosemarie Tüpker vom Studiengang Musiktherapie an der Universität Münster und Hans Hermann Wickel vom Studiengang Soziale Arbeit an der FH Münster erste Seminare zu dem Thema an. Tüpker gibt im Jahr 2001 auch den Anstoß zu einem ersten Fachtag „Musik bis ins hohe Alter“ an der FH Münster. Daraus ist eine umfassende Publikation zu dem Thema entstanden, herausgegeben von Tüpker und Wickel. Auch an anderen Hochschulen werden Praxiserfahrungen im Musizieren mit und von älteren Menschen gesammelt, zum Beispiel durch Barbara Metzger an der Hochschule für Musik Würzburg, Johanna Metz an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, Insuk Lee an der Hochschule für Musik und Theater München oder Marianne Steffen-Wittek an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Die Ansätze von Metzger, Metz und Lee gehen hauptsächlich aus der Didaktik der Elementaren Musikpädagogik hervor, während Steffen-Wittek mit der Methodik der Rhythmik arbeitet. Durch Kontakte zum Schott-Verlag kommt es zum ersten grundlegenden Studienbuch der Musikgeragogik „Musizieren im Alter – Arbeitsfelder und Methoden“, nachdem Theo Hartogh 2005 in seiner Habilitation die Musikgeragogik als Fachdisziplin erstmalig wissenschaftlich etabliert und verortet hatte. Es folgt 2011 (ebenfalls im Schott-Verlag) das erste umfassende „Praxishandbuch Musizieren im Alter – Projekte und Initiativen“ unter Mitwirkung zahlreicher namhafter Autor*innen aus dem akademischen Feld wie aus der Praxis.
Wickel und Hartogh verbindet eine längere Zusammenarbeit, aus der auch das 2004 erschienene Handbuch „Musik in der Sozialen Arbeit“ hervorgeht, in dem bereits die musikalische Arbeit mit Älteren thematisiert wurde. Die beiden Autoren verfassen zahlreiche Beiträge zur Musikgeragogik in Handbüchern, Lexika und Fachzeitschriften. Im Jahr 2012 starten sie im Waxmann Verlag Münster die Herausgabe der Reihe „Musikgeragogik“, um die Veröffentlichung wissenschaftlicher Literatur, insbesondere auch Dissertationen (betreut durch Theo Hartogh und Kai Koch) zu ermöglichen (etwa zum Klavierunterricht mit demenziell erkrankten Menschen, zum intergenerativen Singen und zur Kirchenmusikgeragogik).
Weiterbildung
Die intensive Beschäftigung mit dem Arbeitsfeld führt 2004 an der FH Münster zur Etablierung der hochschulzertifizierten Weiterbildung „Musikgeragogik“, für die der wissenschaftliche Leiter Hans Hermann Wickel 2006 den Inventio-Preis des Deutschen Musikrats (DMR) erhält. Daraufhin führt der DMR 2007 den großen Kongress „Es ist nie zu spät – Musik 50plus“ in Wiesbaden durch und verabschiedet die wegweisende „Wiesbadener Erklärung“, eine Forderung an Politik und Gesellschaft, musikalische Bildung im Alter und Teilhabemöglichkeit älterer Menschen stärker zu fördern. Die Musikgeragogik-Weiterbildung bekommt derweil zahlreiche „Ableger“: Es werden Kurse etabliert an der Landesmusikakademie Berlin, am Nordkolleg Rendsburg (Schleswig-Holstein), an der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen, vom Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen e. V. in Hammelburg sowie vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e. V. in Trossingen. Eine besondere Ausrichtung erhält der Kurs an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Engers mit dem Fokus auf „Musik und Demenz“, organisiert durch die Mainzer Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz und in Zusammenarbeit mit der FH Münster. Bei allen zertifizierten Hochschulweiterbildungen fungiert Theo Hartogh als wissenschaftlicher Berater und Mitgestalter des Curriculums.
In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur (kubia) wird 2011 die zertifizierte Hochschulweiterbildung „Kulturgeragogik“ an der FH Münster ins Leben gerufen. Von Beginn an ist Musikgeragogik ein wichtiger inhaltlicher Bestandteil.
Verbandsarbeit
Im Jahr 2009 kommt es zur Gründung der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik e. V. (DGfMG) an der FH Münster mit Hans Hermann Wickel als ersten und Theo Hartogh als zweiten Vorsitzenden. Beide haben im vergangenen Jahr nach 15 Jahren ihre Ämter an Kai Koch und Kerstin Schatz weitergegeben. Die Gesellschaft ist über die Jahre auf 275 Mitglieder gewachsen. Zahlreiche Arbeitskreise (z. B. zum Aspekt der Musik in der Pflege, zu Musik und Demenz, zur Musikschularbeit, zur Rhythmik, zur Kirchenmusikgeragogik, zum intergenerationellen Musizieren oder zur biografischen Orientierung) bringen seitdem wichtige Themen der Musikgeragogik voran. Die DGfMG ist zudem Mitglied im Deutschen Musikrat, im Landesmusikrat NRW sowie im Fachverband Kunst- und Kulturgeragogik.
Die ebenfalls seit 2009 von der FH Münster und der Münsteraner Katholisch-Sozialen Akademie Franz Hitze Haus in Kooperation mit der DGfMG jährlich stattfindenden Fachtage „Musikgeragogik“ mit unterschiedlicher Ausrichtung (z. B. zu Methoden der Musikgeragogik, Demenz, Spiritualität, Intergenerationalität, Interdisziplinarität, Lebensqualität, Ensemble-Musizieren) bringen unter Mitwirkung namhafter Referent*innen – wie beispielsweise Andreas Kruse, Eckart Altenmüller, Heiner Gembris – zahlreiche Akteur*innen der Musikgeragogik in fachlichen Austausch. Tagungen der Universität Vechta, teilweise in Kooperation mit der Katholischen Akademie Stapelfeld in Cloppenburg, nehmen spezielle Themen in den Fokus, etwa Demenz und Musik (Theo Hartogh) oder Intergenerationelles Musizieren (Kai Koch).
Internationale Netzwerke
Theo Hartogh hat im Rahmen von Erasmus-Programmen wichtige Kontakte ins Ausland und einen akademischen Austausch mit Kolleg*innen ermöglicht, zum Beispiel aus Österreich, Finnland, Litauen, Lettland und Luxemburg, und den musikgeragogischen Ansatz international bekannt gemacht. Zu einer besonderen Zusammenarbeit kommt es mit der Hochschule Luzern. Dort entsteht einerseits eine weitere hochschulzertifizierte Weiterbildung, die Certificate of Advanced Studies (CAS) als Modul eines Masterstudiengangs, und andererseits die Gründung des Berufsverbands, der Gesellschaft für Musikgeragogik Schweiz (federführend durch Andrea Kumpe und Marc Brand).
An den Hochschulen, an denen die Initiatoren der Musikgeragogik arbeiten bzw. gearbeitet haben, ist die Musikgeragogik selbstverständlicher Bestandteil der Lehre und Forschung (Hartogh an der Universität Vechta, Koch an der PH Karlsruhe und Wickel an der FH Münster).
An den Musikhochschulen sind es vor allem Kolleg*innen aus der Elementaren Musikpädagogik, die Musikgeragogik in die Lehre implementieren (wie ehedem Barbara Metzger in Würzburg und jetzt Michael Forster oder Elias Betz und Simone Reisner in Mannheim). In Österreich machen sich vor allem Monika Mayr, Claudia Bauer und Heike Henning an ihren Ausbildungsstätten für das Thema Musikgeragogik in Forschung und Lehre stark.
Zukunftsforschung
Zukunftsweisend ist die Implementierung des Lehrauftrags von Hans Hermann Wickel an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, aus dem bereits zwei erfolgreiche Masterarbeiten hervorgingen. Zudem haben sich zahlreiche engagierte Studierende aus der Perspektive der Rock-, Pop- und Jazzmusik in das musikgeragogische Feld begeben – Musikgenres, die gerade für die Generation der nunmehr ins Alter vorrückenden Babyboomer*innen mehr und mehr eine Rolle spielen.
Die DGfMG widmet sich – neben ihren spezifischen Aktivitäten in den Arbeitskreisen aktuell besonders zwei zentralen Themenfeldern: „Musik und Demenz“ sowie „Transfer musikgeragogischer Ansätze“.
Aus der Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Hamburg e. V., der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft e. V. und dem Deutschen Musikrat e. V. entwickelt sich die Gründung der Bundesinitiative Musik und Demenz, mit dem Ziel, der wachsenden Zahl von demenzbetroffenen Menschen im Rahmen ihrer Behandlung, Pflege und Betreuung möglichst umfassende kulturelle und soziale Teilhabe sowie eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Dabei sollen Akteur*innen die vielfältigen Potenziale von Musik entschlossener und deutlich stärker als bisher nutzen.
Im Jahr 2024 wird die DGfMG Mitglied der Nationalen Demenzstrategie und ist seitdem maßgeblich in die Arbeit der Bundesinitiative eingebunden. Sie initiiert Forschungs- und Transferprojekte, baut Netzwerke weiter aus und engagiert sich für die gesellschaftliche sowie politische Verankerung des Themas – etwa durch parlamentarische Frühstücke, Fachtagungen und offene Online-Themenabende. Besonders prägend ist die enge Zusammenarbeit mit Länger fit durch Musik, einer Initiative des Bundesmusikverbands Chor und Orchester e. V. im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie. Hier bringt die DGfMG ihre Expertise in Forschung und Weiterbildung ein, um nachhaltige musikgeragogische Impulse für den Umgang mit Demenz zu setzen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie musikgeragogische Perspektiven in bestehenden Strukturen musikalischer Bildung weiterentwickelt werden können. In einer Klausurtagung 2024 hat sich der Vorstand intensiv mit diesen Potenzialen in unterschiedlichen Feldern auseinandergesetzt. Der Bereich der Musikschulen scheint – beispielsweise anknüpfend an die bereits erwähnte „Wiesbadener Erklärung“ – noch immer ein Feld musikalischer Bildung zu sein, in dem musikgeragogische Expertise Strukturen und Konzepte bereichern kann. Die DGfMG ist daher eng im inhaltlichen Austausch mit Verbänden auf Landes- und Bundesebene – ebenso wie mit kirchenmusikalischen Institutionen.
Mit diesen Schwerpunkten setzt die DGfMG grundlegende Impulse für die Zukunft der Musikgeragogik – sowohl in der Forschung als auch in der praktischen Umsetzung.